Was bedeutet uns der Dreikönigstag
Zeichen und Symbole
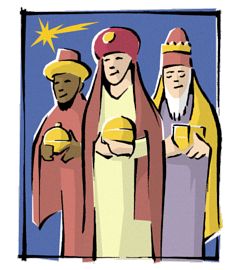
Heilige Drei Könige
Caspar, Melchior und Balthasar – unter diesen Namen sind die Hl.
Drei Könige bekannt. Am 6. Januar werden die entsprechenden Figuren
an die Krippe gestellt. In der Bibel ist aber weder von Königen,
noch von einer Dreizahl die Rede. Hier heißt es schlicht: „Als
Jesus geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem
Osten“
(vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 1).
Die Dreizahl der Sterndeuter wurde schon im 3. Jahrhundert aus der Anzahl der zum Jesuskind gebrachten Gaben geschlossen (vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 11). Erst später wurden die drei Sterndeuter dann den drei damals bekannten Kontinenten Afrika, Asien und Europa zugeordnet. Und auch die Alterszuordnung, Balthasar als Greis, Melchior als Mann mittleren Alters und Caspar als Jüngling, entstammt späterer Zeit. Doch die inhaltliche Aussage dieser volkstümlichen Deutung ist offensichtlich: die ganze Welt und die Menschen allen Alters sollen zu Christus, dem Erlöser, finden.
Auch die Darstellung der Sterndeuter als Könige ist eine nachträgliche Interpretation der biblischen Erzählung: Den mittelalterlichen Menschen war bekannt und vertraut, dass Kaiser und Könige ihre Machtverhältnisse unter anderem durch Tributzahlungen regelten. Der (übergeordnete) Kaiser erkannte mit der Annahme dieser Zahlungen den untergebenen Herrscher als König an. Da nun die Sterndeuter Gaben zum Jesuskind, dem Gottessohn, brachten, ‚erhob’ man sie entsprechend dem mittelalterlichen Erfahrungshintergrund in den Stand von Königen.
Die Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe sind symbolisch zu verstehen:
Die einen sehen darin Aussagen über das in der Krippe liegende Kind. So steht das Gold als Zeichen seines Königtums, der Weihrauch als Zeichen seiner Gottheit und die Myrrhe als Zeichen für sein Menschsein.
Andere deuten das Gold als Weisheitssymbol (so weise wie ein König), den Weihrauch als Symbol für Opferbereitschaft und Gebet (denn der Rauch steigt zum Himmel auf) und die Myrrhe als Zeichen reinhaltender Kraft und Selbstbeherrschung (als Hinweis auf die Passion).
(vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 1).
Die Dreizahl der Sterndeuter wurde schon im 3. Jahrhundert aus der Anzahl der zum Jesuskind gebrachten Gaben geschlossen (vgl. Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 11). Erst später wurden die drei Sterndeuter dann den drei damals bekannten Kontinenten Afrika, Asien und Europa zugeordnet. Und auch die Alterszuordnung, Balthasar als Greis, Melchior als Mann mittleren Alters und Caspar als Jüngling, entstammt späterer Zeit. Doch die inhaltliche Aussage dieser volkstümlichen Deutung ist offensichtlich: die ganze Welt und die Menschen allen Alters sollen zu Christus, dem Erlöser, finden.
Auch die Darstellung der Sterndeuter als Könige ist eine nachträgliche Interpretation der biblischen Erzählung: Den mittelalterlichen Menschen war bekannt und vertraut, dass Kaiser und Könige ihre Machtverhältnisse unter anderem durch Tributzahlungen regelten. Der (übergeordnete) Kaiser erkannte mit der Annahme dieser Zahlungen den untergebenen Herrscher als König an. Da nun die Sterndeuter Gaben zum Jesuskind, dem Gottessohn, brachten, ‚erhob’ man sie entsprechend dem mittelalterlichen Erfahrungshintergrund in den Stand von Königen.
Die Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe sind symbolisch zu verstehen:
Die einen sehen darin Aussagen über das in der Krippe liegende Kind. So steht das Gold als Zeichen seines Königtums, der Weihrauch als Zeichen seiner Gottheit und die Myrrhe als Zeichen für sein Menschsein.
Andere deuten das Gold als Weisheitssymbol (so weise wie ein König), den Weihrauch als Symbol für Opferbereitschaft und Gebet (denn der Rauch steigt zum Himmel auf) und die Myrrhe als Zeichen reinhaltender Kraft und Selbstbeherrschung (als Hinweis auf die Passion).

Dreikönigsschrein
Seit dem 23.Juli 1164 befinden sich die Reliquien der ‚Heiligen
Drei Könige’ im Kölner Dom. Eine alte Erzählung berichtet, dass die
drei Könige im Jahre 53 oder 54 gemeinsam das Weihnachtsfest
gefeiert haben. Kurz danach seien sie rasch hintereinander
gestorben und gemeinsam in Mailand beigesetzt worden. Von dort
seien ihre Gebeine 1164 nach Köln gekommen. Hier entstand zwischen
1180 und 1225 der kostbare Dreikönigsschrein, der noch heute im
Kölner Dom zu bewundern ist.
Legenden berichten in der Regel über das Leben der Heiligen. Bei den Heiligen Drei Königen ist das anders. Von ihrem Leben ist nur weniges überliefert. Und was bekannt ist, sagt nichts aus über ihr Leben, sondern über Jesus Christus: er ist es, dem Anbetung und Verehrung zukommen. Die Frage, ob nun die Reliquien tatsächlich von den ‚Sterndeutern’ der Bibel stammen, ist eher zweitrangig und wohl auch nicht zu klären. Wichtig ist, dass seit vielen Jahrhunderten die Menschen mit der Pilgerfahrt zum Dreikönigenschrein Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen und verehren – so wie die ‚Könige’.
Legenden berichten in der Regel über das Leben der Heiligen. Bei den Heiligen Drei Königen ist das anders. Von ihrem Leben ist nur weniges überliefert. Und was bekannt ist, sagt nichts aus über ihr Leben, sondern über Jesus Christus: er ist es, dem Anbetung und Verehrung zukommen. Die Frage, ob nun die Reliquien tatsächlich von den ‚Sterndeutern’ der Bibel stammen, ist eher zweitrangig und wohl auch nicht zu klären. Wichtig ist, dass seit vielen Jahrhunderten die Menschen mit der Pilgerfahrt zum Dreikönigenschrein Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen und verehren – so wie die ‚Könige’.

Dreikönigssingen
Das Dreikönigssingen ist urkundlich bereits im 16. Jahrhundert
erwähnt. Seit 1959 wird es in Deutschland in jedem Jahr mit einer
sozialen und pastoralen Aktion verbunden, der ‚Sternsingeraktion’:
Als Könige verkleidet ziehen Kinder und Jugendliche in den Tagen um
den 6.Januar von Haustür zu Haustür. Die ‚Könige’ bringen die
Botschaft von Bethlehem zu den Menschen. Wo es gewünscht wird,
schreiben sie den Segen an die Haustür:
20*C+M+B*13.
Die Buchstaben stehen nicht etwa für Caspar, Melchior und Balthasar. Sie sind die Abkürzung für den lateinischen Satz ‚Christus Mansionem Benedicat“, „Der Herr segne dieses Haus“. Dann bitten die ‚Könige’ um eine Spende für Kinder in Not. Das gesammelte Geld wird überwiesen an die Träger dieser Aktion, das ‚Päpstliche Missionswerk der Kinder’ und den ‚Bund der Deutschen Katholischen Jugend’. Mit dem Geld werden Projekte für Kinder in Not unterstützt.
20*C+M+B*13.
Die Buchstaben stehen nicht etwa für Caspar, Melchior und Balthasar. Sie sind die Abkürzung für den lateinischen Satz ‚Christus Mansionem Benedicat“, „Der Herr segne dieses Haus“. Dann bitten die ‚Könige’ um eine Spende für Kinder in Not. Das gesammelte Geld wird überwiesen an die Träger dieser Aktion, das ‚Päpstliche Missionswerk der Kinder’ und den ‚Bund der Deutschen Katholischen Jugend’. Mit dem Geld werden Projekte für Kinder in Not unterstützt.

