Wie es früher war
Über seine Christkönnigserinnerungen aus Kindertagen berichtet Herr
Fährmann (geb. 1929).
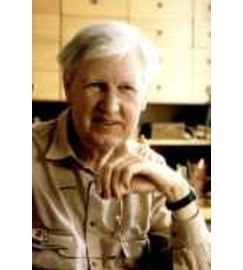
Herr Fährmann
Willi Fährmann ist ein bekannter Kinder- und Jugendbuchautor. In
vielen seiner Werke befasst er sich mit einer sehr dunklen Zeit der
deutschen Geschichte: der Zeit des Nationalsozialismus und des
zweiten Weltkrieges. Willi Fährmann hat diese Zeit als Kind und
Jugendlicher miterlebt, denn er wurde 1929 geboren und war bei
Kriegsbeginn 10 Jahre alt. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, dort
lebte er mit Mutter und Vater, aber leider, wie er sagt, ohne
Geschwister. Heute hat Herr Fährmann eine große Familie mit drei
Kindern und 6 Enkelkindern.
Über den Christkönigs-Sonntag erzählt uns Herr Fährmann:
„Als Kind habe ich das Christkönigsfest nicht bewusst erlebt. Auch im allgemeinen Bewusstsein war es nicht so sehr verwurzelt. Bis zu uns Kindern ist es jedenfalls nicht vorgedrungen – im Krieg vielleicht auch deshalb nicht, weil die katholische Jugend zunächst nur geduldet war, 1938 ja sogar verboten wurde.
Dass es aber vor dem Verbot ein besonderes Fest für die katholischen Jugendorganisationen war, weiß ich aus Erzählungen von Älteren. Der Christkönigstag wurde als eine Art Bekenntnistag , eine Art ‚Kampftag’, gestaltet: Da gab es feierliche Gottesdienste und auch Demonstrationen. Das wurde ganz bewusst so gestaltet, um dem damaligen Zeitgeist zu widersprechen. Es sollte aussagen: Christus ist unser höchster Herr, nicht Adolf Hitler. Es war schon mutig, sich dem anzuschließen, zumal in der Nazizeit die äußeren Zeichen der katholischen Jugend verboten waren. 1934/35 durfte man schon gar nichts mehr, keine Wimpel und Banner mehr öffentlich zeigen und auch keine Gruppentreffen mehr abhalten.“
Vielleicht fragst du dich jetzt, warum es denn mit den katholischen Jugendgruppen und dem Widerstand gegen die Hitler-Diktatur nicht weiterging. Doch das ist gar nicht so schnell zu erklären. Willi Fährmann hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt ‚Unter der Asche die Glut’. Dass es wirklich hilft, die damalige Zeit besser zu verstehen, wird deutlich in dem, was Herr Fährmann erzählt:
„Ein älterer Herr aus der Gegend um Köln erzählte mir einmal, dass er von Kindern und Enkeln immer wieder gefragt wurde, warum er damals nichts gegen die Nazis unternommen habe. Dann ist er auf das Buch ‚unter der Asche die Glut’ gestoßen. Er hat es für seine 16 Enkel und Neffen gekauft und es allen zu Weihnachten geschenkt. Dann hätten sie ein Gespräch darüber geführt. Seitdem würde die Frage ‚Warum habt ihr nicht mehr Widerstand geleistet?’ nicht mehr gestellt.“
(Auf unserer Seite ‚Literatur’ in der Rubrik ‚Das Fest’ findest du eine kurze Beschreibung dieses Buches und die Angaben, die du brauchst, um das Buch im Buchhandel zu bestellen.)
Aber wie ging es nun nach dem Krieg mit dem Christkönigssonntag und den Jugendgruppen weiter?
„Das Fest haben dann verschiedene Jugendbünde, die es in der katholischen Jugend gab, nach dem Krieg wieder in besonderer Weise aufgegriffen. Da war der ‚Christkönigstag´ mit einer festlichen Messe, mit Wimpeln und Bannern und mit anschließenden Treffen wieder lebendig. Das waren dann äußere Zeichen dafür ‚wir gehören zusammen’ und ‚wir gehören zur Kirche’. Oft trafen sich die Jugendlichen aus dem ganzen Dekanat, da kamen oft mehr als 1000 Leute zusammen. Hinterher gab es in den Gruppenstunden darüber Gespräche. Es wurden zum Beispiel die romanischen Kreuzesdarstellungen wieder sehr favorisiert, weil Christus dort als ‚Kyrios’, als Herrscher, dargestellt wird. Es wurde ins Bewusstsein gerückt: Christus ist der Herr.“
Doch das Fest stand nicht für sich allein, sondern hing eng zusammen mit den Jugendgruppentreffen, die das ganze Jahr hindurch stattfanden.
„Die Jugendgruppen, die diese Messen am Christkönigstag besuchten, haben sich üblicherweise jede Woche einmal getroffen und Gruppenstunde abgehalten. Die 2- 2 ½ Stunden waren gegliedert: da gab es zunächst einmal die Schriftlesung und das Reden über die Heilige Schrift. Das dauerte etwa 20 Minuten. Und dann gab es ein Thema über Fragen von Gott und die Welt. Da konnte also alles zum Thema gemacht werden, worüber Jugendliche sprechen wollten: über Sexualität, über Feste , auch über die Programme der Parteien und über die Politiker. Politische Fragen waren ein heißes Thema nach dem Krieg, zum Beispiel die Frage nach Wiederbewaffnung oder nicht. Das wurde auch innerhalb der katholischen Jugend sehr kontrovers diskutiert. Und es hat dramatische Streitgespräche gegeben. Das alles spielte sich im Wesentlichen in den Gruppenstunden ab. Zugleich wurden dort die Augen geöffnet für einen Raum des Musischen. Ich z.B. bin in einer Arbeiterpfarrei groß geworden, wo der musische Bereich normalerweise nicht besonders gepflegt wurde. Die Eltern sangen mit den Kindern und spielten auch, aber ins Theater oder gar in ein Ballett zu gehen oder ganz bestimmte Filme zu sehen oder darüber zu diskutieren, das war in den Familien kaum üblich. Das alles, dieser ganze Bereich des Jugend-Lebens, der wurde uns durch die Gruppen aufgeschlossen und da hatte eben auch der Christkönigstag im religiösen Bereich seine ganz besondere Bedeutung.“
Über den Christkönigs-Sonntag erzählt uns Herr Fährmann:
„Als Kind habe ich das Christkönigsfest nicht bewusst erlebt. Auch im allgemeinen Bewusstsein war es nicht so sehr verwurzelt. Bis zu uns Kindern ist es jedenfalls nicht vorgedrungen – im Krieg vielleicht auch deshalb nicht, weil die katholische Jugend zunächst nur geduldet war, 1938 ja sogar verboten wurde.
Dass es aber vor dem Verbot ein besonderes Fest für die katholischen Jugendorganisationen war, weiß ich aus Erzählungen von Älteren. Der Christkönigstag wurde als eine Art Bekenntnistag , eine Art ‚Kampftag’, gestaltet: Da gab es feierliche Gottesdienste und auch Demonstrationen. Das wurde ganz bewusst so gestaltet, um dem damaligen Zeitgeist zu widersprechen. Es sollte aussagen: Christus ist unser höchster Herr, nicht Adolf Hitler. Es war schon mutig, sich dem anzuschließen, zumal in der Nazizeit die äußeren Zeichen der katholischen Jugend verboten waren. 1934/35 durfte man schon gar nichts mehr, keine Wimpel und Banner mehr öffentlich zeigen und auch keine Gruppentreffen mehr abhalten.“
Vielleicht fragst du dich jetzt, warum es denn mit den katholischen Jugendgruppen und dem Widerstand gegen die Hitler-Diktatur nicht weiterging. Doch das ist gar nicht so schnell zu erklären. Willi Fährmann hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt ‚Unter der Asche die Glut’. Dass es wirklich hilft, die damalige Zeit besser zu verstehen, wird deutlich in dem, was Herr Fährmann erzählt:
„Ein älterer Herr aus der Gegend um Köln erzählte mir einmal, dass er von Kindern und Enkeln immer wieder gefragt wurde, warum er damals nichts gegen die Nazis unternommen habe. Dann ist er auf das Buch ‚unter der Asche die Glut’ gestoßen. Er hat es für seine 16 Enkel und Neffen gekauft und es allen zu Weihnachten geschenkt. Dann hätten sie ein Gespräch darüber geführt. Seitdem würde die Frage ‚Warum habt ihr nicht mehr Widerstand geleistet?’ nicht mehr gestellt.“
(Auf unserer Seite ‚Literatur’ in der Rubrik ‚Das Fest’ findest du eine kurze Beschreibung dieses Buches und die Angaben, die du brauchst, um das Buch im Buchhandel zu bestellen.)
Aber wie ging es nun nach dem Krieg mit dem Christkönigssonntag und den Jugendgruppen weiter?
„Das Fest haben dann verschiedene Jugendbünde, die es in der katholischen Jugend gab, nach dem Krieg wieder in besonderer Weise aufgegriffen. Da war der ‚Christkönigstag´ mit einer festlichen Messe, mit Wimpeln und Bannern und mit anschließenden Treffen wieder lebendig. Das waren dann äußere Zeichen dafür ‚wir gehören zusammen’ und ‚wir gehören zur Kirche’. Oft trafen sich die Jugendlichen aus dem ganzen Dekanat, da kamen oft mehr als 1000 Leute zusammen. Hinterher gab es in den Gruppenstunden darüber Gespräche. Es wurden zum Beispiel die romanischen Kreuzesdarstellungen wieder sehr favorisiert, weil Christus dort als ‚Kyrios’, als Herrscher, dargestellt wird. Es wurde ins Bewusstsein gerückt: Christus ist der Herr.“
Doch das Fest stand nicht für sich allein, sondern hing eng zusammen mit den Jugendgruppentreffen, die das ganze Jahr hindurch stattfanden.
„Die Jugendgruppen, die diese Messen am Christkönigstag besuchten, haben sich üblicherweise jede Woche einmal getroffen und Gruppenstunde abgehalten. Die 2- 2 ½ Stunden waren gegliedert: da gab es zunächst einmal die Schriftlesung und das Reden über die Heilige Schrift. Das dauerte etwa 20 Minuten. Und dann gab es ein Thema über Fragen von Gott und die Welt. Da konnte also alles zum Thema gemacht werden, worüber Jugendliche sprechen wollten: über Sexualität, über Feste , auch über die Programme der Parteien und über die Politiker. Politische Fragen waren ein heißes Thema nach dem Krieg, zum Beispiel die Frage nach Wiederbewaffnung oder nicht. Das wurde auch innerhalb der katholischen Jugend sehr kontrovers diskutiert. Und es hat dramatische Streitgespräche gegeben. Das alles spielte sich im Wesentlichen in den Gruppenstunden ab. Zugleich wurden dort die Augen geöffnet für einen Raum des Musischen. Ich z.B. bin in einer Arbeiterpfarrei groß geworden, wo der musische Bereich normalerweise nicht besonders gepflegt wurde. Die Eltern sangen mit den Kindern und spielten auch, aber ins Theater oder gar in ein Ballett zu gehen oder ganz bestimmte Filme zu sehen oder darüber zu diskutieren, das war in den Familien kaum üblich. Das alles, dieser ganze Bereich des Jugend-Lebens, der wurde uns durch die Gruppen aufgeschlossen und da hatte eben auch der Christkönigstag im religiösen Bereich seine ganz besondere Bedeutung.“

