Was feiern wir an Sankt Martin?
Zeichen und Symbole

Helm und Schwert
Der Hl. Martin wird zumeist als römischer Soldat dargestellt. Als
Sohn eines römischen Offiziers trat er selber schon in jungen
Jahren dem Militär bei. Sein Name, Martinus, kommt vom lateinischen
„mars“ und bedeutet: Dem Kriegsgott Mars geweiht. Wie sein Name, so
prägten Krieg und Militär seine Kinder- und Jugendjahre.

Mitra und Bischofsstab
Mit 18 Jahren verließ er den Militärdienst und tauscht die Karriere
gegen ein einfaches Mönchsleben. Seine einfache Lebensweise und
seine Zuwendung zu den bei ihm ratsuchenden Menschen führen dazu,
dass er im Jahre 371 gedrängt wurde, die Bischofswürde anzunehmen.
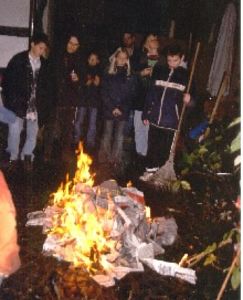
Martinsfeuer
Das Martinsfeuer soll Ausdruck dafür sein, dass Gott sich mit Licht
und Wärme den Menschen zuwendet. Am Martinstag abgebrannt, verweist
es auf einen Menschen, durch dessen Leben die Liebe und Wärme
Gottes für die Menschen spürbar wurde.

Martinsgänse
Die Martinsgans erinnert an eine Legende aus Martins Leben: Martin
wollte das Bischofsamt eigentlich nicht übernehmen. Als die
Menschen kamen, um ihn in die Stadt zu holen, versteckte er sich im
Gänsestall. Mit ihrem lauten Geschnatter verrieten ihn die Gänse.
Zur Strafe wurden sie geschlachtet und verzehrt. Wahrscheinlicher
aber ist ein ganz pragmatischer Grund für das Schlachten der
Martinsgänse: Am Ende des Herbstes wurden Tiere, deren Durchfüttern
durch den Winter zu teuer war, geschlachtet und als Lohn an Knechte
bzw. als Pachtzins abgegeben. Die Zuordnung zum Martinsfest
erfolgte wohl erst später.

