Was bedeutet uns Pfingsten
Zeichen und Symbole
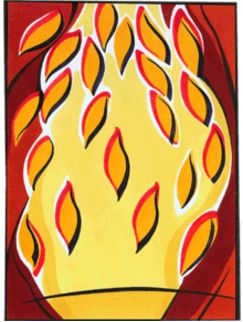
Feuerzunge
„Am Anfang war das Feuer“, so lautet der Titel eines vor einigen
Jahren viel beachteten Kinofilmes. Die Entwicklung der Menschheit
war eng bezogen auf den Besitz des Feuers. Vom Besitz des Feuers
war abhängig, ob Leben existieren konnte oder unterging. Das Hüten
des Feuers, das durch Blitze vom Himmel gekommen war, bot die
Grundlage menschlicher Existenz. Das Feuer bot Wärme, es erhellte
die Dunkelheit.
„Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,…“ heißt es in den Pfingsterzählungen des Neuen Testaments (nachzulesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 3). Der neuzeitliche Mensch assoziiert Feuer zumeist mit Krieg und Katastrophen. Zeitgenossen Jesu erlebten das anders. Im Feuer sahen sie Kraft, Licht und Wärme. Die Autoren des ersten, des ‚alten’ Testamentes stellten Begegnungen zwischen Gott und den Menschen mit dem Bild des Feuers dar: Gott, anwesend in der Feuersäule, die die Israeliten sicher durch die Wüste geleitete, Gott im brennenden Dornbusch. Gottes Kraft war wärmend und erhellend spürbar, aber sie ‚verbrannte’ und ‚vernichtete’ die Menschen nicht.
Der Vergleich mit dem Feuer in der Pfingsterzählung des Neuen Testamentes verweist auf den himmlischen Ursprung dessen, was Pfingsten geschehen ist: Dass die Freunde Jesu den Mut fanden, aus ihrem Versteck herauszugehen und für die ‚Sache Jesu’ einzutreten, ermöglicht durch die Geistsendung, das wunderbare Eingreifen Gottes.
„Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,…“ heißt es in den Pfingsterzählungen des Neuen Testaments (nachzulesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 3). Der neuzeitliche Mensch assoziiert Feuer zumeist mit Krieg und Katastrophen. Zeitgenossen Jesu erlebten das anders. Im Feuer sahen sie Kraft, Licht und Wärme. Die Autoren des ersten, des ‚alten’ Testamentes stellten Begegnungen zwischen Gott und den Menschen mit dem Bild des Feuers dar: Gott, anwesend in der Feuersäule, die die Israeliten sicher durch die Wüste geleitete, Gott im brennenden Dornbusch. Gottes Kraft war wärmend und erhellend spürbar, aber sie ‚verbrannte’ und ‚vernichtete’ die Menschen nicht.
Der Vergleich mit dem Feuer in der Pfingsterzählung des Neuen Testamentes verweist auf den himmlischen Ursprung dessen, was Pfingsten geschehen ist: Dass die Freunde Jesu den Mut fanden, aus ihrem Versteck herauszugehen und für die ‚Sache Jesu’ einzutreten, ermöglicht durch die Geistsendung, das wunderbare Eingreifen Gottes.

Tauben
Das Bild freigelassener, zum Himmel aufsteigender Tauben zu Beginn
olympischer Spiele, bei Hochzeiten oder zu anderen feierlichen
Ereignissen ist vielen präsent. Der Bibelkundige erinnert sich
dabei gerne an die ‚Friedenstaube’, die nach der großen Sintflut zu
Noah zurückkehrte und ihm mit der Übergabe eines grünen
Olivenzweiges den Beginn eines neuen Zeitalters ankündigte
(nachzulesen im Buch Genesis des Alten Testaments: Kapitel 8, Vers
8 - 11).
Das Bild der Taube wird in der christlichen Ikonographie seit langem genutzt, um den Hl. Geistes und sein Kommen und Wirken in dieser Welt darzustellen. Ihren Ursprung hat diese Darstellung in der biblischen Erzählung von der Taufe Jesu im Jordan (nachzulesen im Markusevangelium, Kapitel 1, Vers 10 oder im Lukasevangelium Kapitel 3, Vers 22 ). Die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte nutzt dieses Symbol allerdings nicht, sondern berichtet von ‚Feuerzungen’ und ‚Sturmesbrausen’.
Das Bild der Taube wird in der christlichen Ikonographie seit langem genutzt, um den Hl. Geistes und sein Kommen und Wirken in dieser Welt darzustellen. Ihren Ursprung hat diese Darstellung in der biblischen Erzählung von der Taufe Jesu im Jordan (nachzulesen im Markusevangelium, Kapitel 1, Vers 10 oder im Lukasevangelium Kapitel 3, Vers 22 ). Die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte nutzt dieses Symbol allerdings nicht, sondern berichtet von ‚Feuerzungen’ und ‚Sturmesbrausen’.

